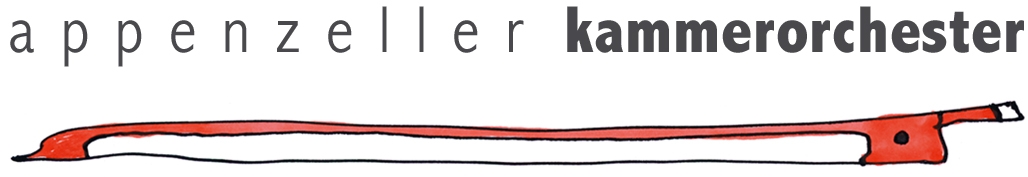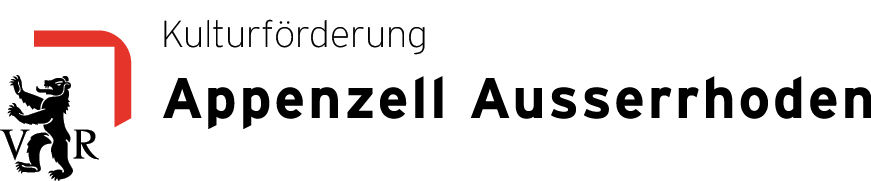Ein Interview mit dem Dirigenten Jürg Surber zur Aufführung des Requiems
Jürg Surber, seit 1995 leitest du den Gemischten Chor Wald, seit 2003 das heutige Appenzeller Kammerorchester. Nun hast du dich für ein erstes grosses gemeinsames Konzert entschieden. Weshalb hast du gerade das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart dafür ausgesucht, und welche persönliche Beziehung hast du zu diesem Werk?
Jürg Surber: Mozarts Requiem ist mir seit meiner Kindheit bekannt und vertraut. Prägend war aber bestimmt eine Aufführung mit SchülerInnen der Kantonsschule Trogen vor einigen Jahren. Es hat mich sehr beeindruckt, wie die Jugendlichen sich emotional in das Stück einbrachten. Die Aufführung damals hatte allerdings nur fragmentarischen Charakter, und so wuchs im Lauf der Zeit der Wunsch, das Requiem als Gesamtwerk aufzuführen. Der Umgang mit Tod und Vergänglichkeit ist wahrscheinlich die schwierigste Herausforderung des Menschseins. Das Projekt mit der Kanti war stark biografisch gefärbt und stellte den Mythos um das Requiem und seinen historischen Zusammenhang ins Zentrum. Heute interessieren mich mehr die existentiellen Fragen und Antworten.
Das Requiem ist in verschiedener Hinsicht kein einfaches Werk. Wie sieht deine persönliche Vorbereitung aus im Vorfeld und jetzt während den Proben zusammen mit Chor und Orchester?
Jürg Surber: Ich habe viel gelesen über das Werk und die heute existierenden Fassungen verglichen. In der musikalischen Vorbereitung suche ich die „Ecken und Kanten“ des Werks, nicht unbedingt den geglätteten harmlosen Mozart. Inhaltlich bringt mir die Auseinandersetzung mit dem Requiemtext eine vertiefte Konfrontation mit der Thematik des Todes, der Endlichkeit und der menschlichen Existenz überhaupt. Ergänzend zum Requiemtext bin ich deshalb auch auf die Suche gegangen nach Texten aus verschiedensten Epochen und Kulturräumen. Meine Idee war es, der Musik Mozarts Texte an die Seite zu stellen, welche die Zuhörenden zu einer vertieften Auseinandersetzung auch mit dem Inhalt anregen. So kam ich auf die Texte von Rumi, über die wir ja später noch sprechen werden.
Darf ein so bekanntes Werk, das meist von professionellen MusikerInnen aufgeführt wird und von dem es ausgezeichnete CD-Aufnahmen gibt, von LaienmusikerInnen überhaupt gespielt werden?
Jürg Surber: Natürlich, das Requiem aufzuführen ist für uns alle eine sehr grosse Herausforderung! Und selbstverständlich sollten die Konzerte auch überzeugend sein. Wenn sie aber musikalisch einigermassen gelingen und von den Musizierenden persönlich ausdrucksstark gestaltet werden, ist eine Laienaufführung sicher berechtigt. Insofern macht es Sinn, sogenannt grosse Literatur zu spielen. Ich stelle auch jetzt wieder beim Requiem fest, dass ein grossartiges Werk die Probenarbeit in jeder Phase spannend und intensiv macht.
Das Requiem war beim Tod Mozarts erst fragmentarisch entstanden und wurde in der Folge von seinen Schülern, vor allem von Franz Xaver Süssmayr, fertiggestellt. Das kann eine gewisse Enttäuschung hervorrufen. Wie ist deine musikalische Einschätzung des Werks? Und welche Rolle spielt die Mythenbildung rings um den frühen Tod Mozarts für die Beliebtheit und die Grösse des Werks?
Jürg Surber: Je mehr ich mich mit dem Werk auseinandersetze und Fachliteratur und romanhafte Schilderungen rings um Mozarts Tod und die Entstehung des Requiems lese, desto weniger wichtig wird mir die historische Frage oder eben auch diejenige des Mythos. Ein Fund bei der Lektüre war, dass es im Requiem nahe Bezüge gibt zum Funeral Anthem for Queen Caroline (The ways of Zion do mourn) von Georg Friedrich Händel. Mozart hatte das Werk studiert und „verwendete“ es für den Introitus-Satz. Das wertet Mozarts Werk nicht ab, sondern zeigt seine Wertschätzung dem Werk Händels gegenüber. Immer ist Kunst auch eine Auseinandersetzung mit bereits Bestehendem. Die ersten beiden Sätze von Händels Anthem bilden deshalb auch den Anfang unserer Konzerte.
Mit dem fragmentarischen Charakter des Requiems und dessen Vollendung durch Mozarts Schüler sehe ich es ähnlich: es gibt nicht nur ‚Original‘ und ‚Nicht-Original‘, das eine besser, das andere schlechter. Es ist ja so, dass die wesentlichen Elemente des Requiems von Mozart komponiert wurden, nämlich der vierstimmige Chorsatz bis zum Sanctus samt Basslinie, die in Barock und Klassik stets das Fundament bildet. Auch liegt die Vermutung nahe, dass das Anknüpfen des letzten Satzes an den Beginn des Werks bereits von Mozart so vorgesehen war. Für unsere Aufführungen habe ich mich für die Fassung von Franz Beyer entschieden, weil die Instrumentierung stimmiger ist als bei Süssmayr, sodass sich ein originaleres und durchsichtigeres Klangbild ergibt, das überzeugt.
Eine Vertiefung in den Text des Requiems, in dem in lateinischer Sprache für das Seelenheil Verstorbener gebetet wird, führt uns in eine uns fremd gewordene Vorstellungs- und Glaubenswelt. Wie gehst du damit um? Und inwiefern beeinflusst der Text die Musik Mozarts?
Jürg Surber: Mich fasziniert, wie eindrücklich und unmittelbar Mozart, der selbstverständlich ein Kind seiner Zeit war, den Text in Musik umsetzt. Ich selbst habe eine gewisse Distanz zum Originaltext. Mit allem Engen, Dogmatischen, Ideologischen oder Missionarischen tue ich mich schwer. Mein Welt- und Gottesbild ist offener als dasjenige des Requiemtextes. Das Werk - wie übrigens geistliche Musik überhaupt - bringt mich, bringt uns dazu, über existentielle Fragen für unser eigenes Leben nachzudenken. Musik ist spirituell in einem umfassenden Sinn. Und da der Tod die absolute Herausforderung unseres Lebens ist, meine ich, dass er Thema jeder ernsthaften Musik ist. Insofern geht uns das Requiem bei aller Fremdheit des Textes unmittelbar etwas an! Und weil ich es hilfreich finde sowohl für die Musizierenden, für mich selbst, aber auch die Zuhörenden, wird in den Konzerten zwischen einzelne musikalische Teile eine Wortspur aus Werken des persischen Mystikers Dschalaluddin Rumi gesetzt, die eine zusätzliche und uns trotz grösserer zeitlicher, räumlicher und kultureller Distanz vielleicht näher liegende Spiritualität eröffnet. Rumis Blick auf die menschliche Existenz ist offen, umfassend und universell, dabei stets liebevoll und ohne den Gedanken von Sühne und Jüngstem Gericht, der für uns heutige Menschen schwierig zu fassen ist.
In den vergangenen Jahren hat das Appenzeller Kammerorchester sich vermehrt mit barocken Werken beschäftigt und an einem authentischen Klangbild gearbeitet. Auch das Requiem wird mit Barockbogen gespielt. Weshalb hast du dich dazu entschieden, und was bedeutet es für die Aufführung des Werks insgesamt?
Jürg Surber: Die Mitglieder des Orchesters haben im Lauf der letzten Jahre Übung und Vertrautheit im Umgang mit dem Barockbogen erlangt. Wenn wir auch für die Musik Mozarts den Barockbogen wählen, ist das Ziel, so durchsichtig und beweglich wie möglich zu spielen. Um eine authentische Aufführungspraxis im engeren Sinn geht es also nicht; dafür wären ja beispielsweise auch Originalinstrumente nötig. Wichtig ist mir vielmehr, nach den Schärfen und Kontrasten in Mozarts Musik zu suchen. Das interessiert mich – weit entfernt also von den süssen Mozartkugeln!
Seit einigen Monaten wird in Chor und Orchester intensiv geprobt. Wie schätzt du den Stand der Vorbereitungen ein? Und was dürfen die Konzertbesuchenden von den Aufführungen erwarten?
Jürg Surber: Die Proben kommen voran, wie ich es mir vorgestellt habe. Und erwarten? Erwarten dürfen die Konzertbesuchenden eine engagierte, von innen heraus mit Feuer gespielte Aufführung, die bewegt.
Jürg Surber, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch.
Interview: Regula Menges-Bachmann (September 2012)