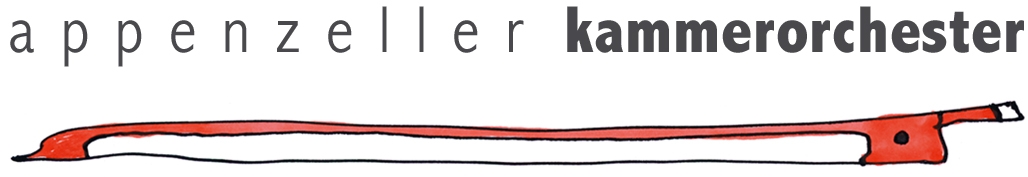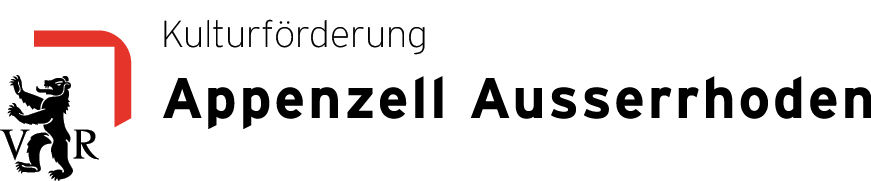"Bach ist ein wirklich grosser des Barock"
Das nächste Projekt des Appenzeller Kammerorchesters sind vier Aufführungen der ersten drei Teile des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach (BWV 248). Jürg Surber, Dirigent, und Christine Baumann, Konzertmeisterin, treffen sich zum Gespräch.
Jürg Surber und Christine Baumann, was klingt in euch an, wenn ihr den Namen Johann Sebastian Bach hört?
Christine Baumann: Bach ist ein wirklich Grosser des Barock, mit dem ich mich schon lange intensiv auseinandersetze und den ich versuche immer besser zu verstehen. Durch seine vielen verschiedenen Werke wird Bach für mich zum Lehrmeister, an dem ich als Geigerin wachsen kann. Immer wieder Neues lässt sich entdecken in Bachs Musik. Oder ich kann mich auch tausendmal vom Selben berühren lassen.
Jürg Surber: Mit Bach kann man sich ein Leben lang beschäftigen, und es eröffnen sich immer neue Schichten. Seine Musik wird nie langweilig oder banal. Ich bin interessiert an dieser Tiefe, musikalisch und gedanklich.
Ihr habt es gesagt: Bach ist einer der herausragenden Komponisten der Barockzeit. Was ist denn für die Barockmusik charakteristisch?
Jürg Surber: Spontan fallen mir vielerlei Analogien beispielsweise zur Architektur der damaligen Zeit ein: die Symmetrien, die Dreiteiligkeit, das Filigrane und Verspielte, manchmal auch etwas Übertriebene… Inhaltlich bewegt sich der Barock zwischen der Lebensfreude, dem Carpe diem, und dem Wissen um die Todesnähe, dem Memento mori.
Christine Baumann: Mir fällt auch die Nähe zur Malerei auf. Die Barockmusik ist enorm farbig und ausdrucksstark.
Heute wird viel von historischer Aufführungspraxis gesprochen. Sie scheint, gerade in Bezug auf barocke Musik, Standard geworden zu sein. Was versteht man unter dem Begriff? Und wie weiss man überhaupt, wie vor dreihundert Jahren musiziert wurde?
Christine Baumann: Ja, es stimmt: Die historische Aufführungspraxis hat sich so etabliert, dass sie heute einfach dazugehört. Als ich mein Studium begann, was die Möglichkeit, ein Barockinstrument im Nebenfach zu wählen, zwar schon fast selbstverständlich. Heute gibt es immer mehr Musikhochschulen, die es sogar im Hauptfach anbieten.
Jürg Surber: Während meines Studiums gab es die Möglichkeit noch nicht einmal im Nebenfach. Die ersten Versuche einzelner kleiner Gruppen, mit modernen Instrumenten ‘echte’ Barockmusik zu spielen, galten damals noch als sehr exotisch! In der Schweiz war die Schola Cantorum Basiliensis die erste Institution, die sich der historischen Aufführungspraxis verschrieb. Als im 19. Jahrhundert von Felix Mendelssohn-Bartholdy und in der Folge auch von anderen die Barockmusik, die eine Zeitlang beinahe vergessen war, wieder ins Bewusstsein gerufen wurde, geschah das mit den damaligen Möglichkeiten. Das Interesse daran, wie barocke Musik zu ihrer Zeit geklungen haben mag, erwachte erst im letzten Jahrhundert. Es ging darum, authentisch zu spielen und möglichst nah an das ursprüngliche Klangbild heranzukommen. Zu Beginn war das eine Sache von spezialisierten MusikwissenschaftlerInnen. Die Umsetzung in die Praxis kam erst in einem zweiten Schritt.
Christine Baumann: Dazu beigetragen hat eine rege Forschungstätigkeit an historischen Quellen, sodass heute viel mehr Information vorhanden ist. Zurückgegriffen werden kann etwa auf Bildmaterial, Faksimile-Ausgaben, theoretische Werke, bis heute erhaltene Instrumente, inzwischen auch auf eine reiche fundierte Fachliteratur.
Jürg Surber: Die ersten Aufnahmen, die dann übrigens auf den Markt kamen, wirkten noch sehr streng und trocken. Seither ist eine grosse Veränderung geschehen.
In meiner Schallplattensammlung aus den 70er Jahren finden sich tatsächlich noch kaum Aufnahmen, die dem gerecht werden, was heute unter historischer Aufführungspraxis verstanden wird. Trotzdem haben Interpretationen, die mir inzwischen schwülstig vorkommen, mir einst gefallen. Grenzt eine als ‘richtig’ geltende Aufführungspraxis nicht auch andere Interpretationsmöglichkeiten aus? Oder anders: Passt sich unser musikalischer Geschmack an den jeweiligen Mainstream an?
 |
Jürg Surber: Es ist bestimmt so, dass sich Hörgewohnheiten entwickeln, indem man gewisse Interpretationen immer wieder hört. Von Ausgrenzung würde ich heute allerdings nicht mehr sprechen. Bei den ersten Versuchen authentischer Interpretationen ging es auf beiden Seiten noch sehr dogmatisch zu. Heute gibt es aber sehr viele Mischformen. Das Wissen ist gewachsen, dass es nicht die absolute Wahrheit gibt. Es geht vielmehr um Lebendigkeit. Eine Konsequenz aus den Diskussionen lässt sich allerdings vermutlich ausmachen: Grosse Symphonieorchester führen heute seltener barocke Werke auf als früher. |
Habt ihr denn eure persönlichen FavoritInnen in der Interpretation barocker Musik?
Christine Baumann: Es gibt verschiedene InterpretInnen, die mich faszinieren; je nach Stück oder meiner eigenen Stimmung wechselt das stark. Ein grosses Vorbild ist für mich der Dirigent Nikolaus Harnoncourt. Er wagte Neues in einer Zeit, als er damit noch auf Unverständnis stiess. Auch er machte innerhalb seines Berufslebens einen weiten Weg. Als Geigerin schätze ich zum Beispiel Amandine Beyer sehr. Die Art, wie einzelne OrchestermusikerInnen, mit denen ich zusammenspiele, an gewisse Dinge herangehen, die Interpretationen einzelner Sänger in bestimmten Stücken – es gibt immer wieder Faszinierendes!
Jürg Surber: Ich habe an den englischen Chorleiter Andrew Parrott eine eindrückliche persönliche Erinnerung. Ich konnte ihn als junger Mann an einem Kurs erleben - wir sangen Lieder der Renaissance -, und eine Zeitlang habe ich dann sehr gern Aufnahmen mit Interpretationen von ihm gehört. Zu Bachs Weihnachtsoratorium habe ich mir in der letzten Zeit verschiedene Aufnahmen angehört, und stets sind es einzelne Elemente, die mich beeindrucken.
Ich meine zu beobachten, dass Barockmusik gegenwärtig erneut eine Renaissance oder sogar einen Höhenflug erlebt. Wie erklärt ihr euch das?
Jürg Surber: Eine schwierige Frage! Überhaupt: Warum wird noch immer klassische Musik im weiteren Sinn gespielt und gehört? Die Studiengänge sind voll… Vermutlich bedient die Barockmusik, ohne sie darauf beschränken zu wollen, das Bedürfnis der Menschen nach Harmonie und Struktur. Sie ist sozusagen hörerfreundlich.
Christine Baumann: Dazu kommt, dass es heute auch zunehmend Angebote gibt, die für eine grössere Allgemeinheit interessant sind, Openair-Konzerte zum Beispiel.
Jürg Surber: Gerade bei jungen Menschen, die mit Pop und Rock gross geworden sind und damit im Alltag leben, beobachte ich, dass sich ihnen durch klassische Musik eine zusätzliche Dimension der Tiefe eröffnen kann, die sie fasziniert.
Christine Baumann: Das erlebe ich auch so. Wenn ich etwa SchülerInnen auf ein bestimmtes Stück aufmerksam mache und sie es sich dann auf Youtube anhören und anschauen - da eröffnen sich heute ja auch zusätzliche Möglichkeiten -, können sie plötzlich auf positive Weise gepackt werden. Das ist schön.
Viele barocke Werke - denken wir an die Kantaten von Johann Sebastian Bach - sind Vertonungen biblischer oder christlich-theologischer Texte in einer altertümlichen Sprache und mit Inhalten, die uns heutigen Menschen eigentlich sehr fremd vorkommen müssten. Wie verträgt sich das mit dem grossen Zuspruch, den entsprechende Aufführungen erfahren? Und wie ist es für euch als InterpretInnen, Werke, die ursprünglich der Verkündigung dienten, aufzuführen?
Jürg Surber: Ich frage mich, wieviel sich die ZuhörerInnen überhaupt mit dem Text abgeben. Ist es nicht vor allem die Musik, die berührt?
Christine Baumann: Ich denke schon. Allerdings wird zum Teil ja auch versucht, für Aufführungen die Texte zusätzlich zu erklären und mit der Musik in einen Zusammenhang zu stellen. Auch mir geht es übrigens so, dass ich die Texte oft nicht wirklich ‘verstehe’. Ich weiss eher allgemein um das Thema, das im Zentrum steht.
Jürg Surber: Aber klar, eigentlich verständlich wird eine Kantate nur, wenn die Texte beim Hören zur Musik hinzugezogen werden. Für mich persönlich ist es so, dass ich als Musiker zuerst selbstverständlich auf die Musik ausgerichtet bin. Immer aber geht es, gerade bei Bach, um Grundthemen der menschlichen Existenz. Mit ihnen verbinden sich Emotionen, die durch die Musik ausgedrückt und so hörbar und wiederum erfühlbar werden. So steht für mich im Zentrum des Weihnachtsoratoriums das Geschehen der Geburt, des Werdens menschlichen Lebens, und mit der Mutterfigur und dem neugeborenen Kind nehmen wir als Kollektiv am Wunder des Lebens teil. Man kann das als religiöse Erfahrung deuten, aber eigentlich geht es um eine grund-existentielle Erfahrung aller Menschen.
 |
Christine Baumann: Bach ist ja ein Meister darin, Texte in Musik zu verwandeln, und damit gibt er dem Wort eine grosse Tiefe. Dabei ist mir der religiöse Aspekt je nach Befindlichkeit schon wichtig. Die Musik macht es auch möglich, zusätzliche Dimensionen aufleuchten zu lassen, eben zum Beispiel im Weihnachtsoratorium bereits beim Geburtsgeschehen den späteren Tod dieses Kindes anzudeuten. Das Schaffen von Emotionen und der Umgang damit beeindrucken mich. Fast könnte man versucht sein zu sagen, Bach sei ein romantischer Komponist! |
Bleiben wir doch gleich noch ein wenig beim Weihnachtsoratorium: Könnt ihr noch etwas mehr zu eurer persönlichen Beziehung dazu sagen?
Christine Baumann: Das Weihnachtsoratorium begleitet mich seit meiner Kindheit und bedeutet mir viel. In meinem Elternhaus war Bach sehr gegenwärtig, und für mich als Kind war das Weihnachtsoratorium dasjenige von Bachs Werken, das mir am besten gefiel. Daraus dann erstmals die Geigenarie aus dem dritten Teil zu spielen, war ein Moment grösster Freude. Stark geprägt hat mich das Werk zweifellos, aber es spricht mich im Lauf des Lebens immer wieder neu und unterschiedlich an. Ich freue mich sehr, auch mit unseren Konzerten im Dezember Bachs Werk den Menschen näherbringen zu können.
Jürg Surber: Auch in mir steigen Kindheitserinnerungen auf; wir hatten in der Familie eine Aufnahme vom Weihnachtsoratorium. Als Jugendlicher habe ich dann einmal mitgesungen im Chor, später spielte ich das Werk als Kontrabassist. Der Anfang des Werks hat etwas Euphorisches, beinahe Ekstatisches neben den ganz verinnerlichten Stellen später – ich freue mich auch darauf, das Werk mit unserem Orchester aufzuführen.
Das Appenzeller Kammerorchester ist ein Laienorchester. Was erwartet ihr von den Proben und den Aufführungen? Und was wird schliesslich die KonzertbesucherInnen erwarten?
Christine Baumann: Der Entscheidung, das Werk aufzuführen, gingen lange Überlegungen unsererseits voraus. Gewiss, es ist ein Wagnis. Aber wir haben ja bereits Erfahrung aus den Aufführungen von Mozarts Requiem vor vier Jahren. Damals wurde mir bewusst, wie für einzelne Orchestermitglieder ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung ging, weil sie einen Bezug hatten zum Werk über viele Jahre schon oder auch aus ihrer ganz speziellen Lebenssituation heraus. Das hat mich sehr bewegt. Darum ist meine Erwartung oder besser Hoffnung, dass auch diesmal das Orchester, der Chor und das Publikum in der Tiefe sich berühren lassen von der Musik und im Miteinander Freude empfinden. Zudem freue ich mich auf die Erarbeitung des Werks, auf die gemeinsame Auseinandersetzung mit ihm.
Jürg Surber: Berührt werden, das ist auch für mich das Stichwort. Es geht um eine andere Ebene als diejenige der Perfektion. Natürlich ist es wichtig, zu arbeiten, zu verbessern und das Werk schliesslich möglichst gut zu spielen. Aber es gibt eine tiefere Erfahrungsschicht, und auf diese kommt es mir an. In diesen Zusammenhang gehört auch das Vorhaben, in Bachs Werk eine zweite Tonspur hineinzulegen, indem einzelne instrumentale und gesungene Elemente aus dem nahöstlichen Kulturkreis zum Klingen kommen sollen. Dadurch entsteht, so hoffe ich, eine zusätzliche Berührungsebene: Ein Geschehen der Zeitenwende im Orient, Musik des 18. Jahrhunderts aus Mitteleuropa und das gegenwärtige, auch weltpolitische Geschehen des 21. Jahrhunderts begegnen sich.
Wie bereits in den Aufführungen von W.A. Mozarts Requiem werden wiederum der Chor Wald und das Appenzeller Kammerorchester die Konzerte gemeinsam gestalten. Was sind die Gründe dafür?
Jürg Surber: Der pragmatische Grund ist, dass ich bei Chor und Orchester Dirigent bin. Das Requiem war ein erster Versuch eines gemeinsamen Projekts, und daraus ist wohl nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Mitwirkenden der Wunsch entstanden, wieder einmal ein grösseres Werk zusammen aufzuführen. Es interessiert mich, auch mit Laienensembles ‘grosse’ Literatur zu spielen und zu singen.
Christine Baumann: Mit dem Chor Wald hat sich in den letzten Jahren ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt, was ich sehr schön finde.
Das Appenzeller Kammerorchester legt einen gewissen Schwerpunkt auf Barockmusik. Es besitzt Barockbogen, und auch an einer barocken Spielweise wird seit längerem gearbeitet. Worin liegen die Besonderheiten, und was ist euer Ziel dabei?
Christine Baumann: Ich nehme wahr, wie das Orchester einen Weg verfolgt und sich entwickelt. Das ist gut so. Entscheidend ist nicht einmal so sehr, welcher Weg es ist. Weil die Barockmusik aber ein gemeinsames Interesse ist von uns beiden, haben wir auch ähnliche Vorstellungen und Ziele. Das ist sehr wichtig.
Jürg Surber: Es ist ja so, dass in unserem Orchester gewisse Parameter einfach gegeben sind: Wir haben zwar Barockbogen, spielen aber auf modernen Instrumenten und stimmen auf 440 Hz. ‘Historisch informierte Aufführungspraxis’: der Begriff passt meiner Meinung nach gut! Wir haben ein gewisses Instrumentarium zur Verfügung, und die Frage ist, was wir damit machen.
Christine Baumann: Ich denke, so ist es für unser Ensemble ein guter Mittelweg. Auch eine Herausforderung, mit Barockbogen und modernen Instrumenten ein möglichst ideales Klangbild zu finden…
Zum Schluss noch eine allgemeine Frage: Wie seht ihr die Zusammenarbeit und allenfalls die Entwicklung innerhalb des Kammerorchesters während eurer langjährigen Leitung? Worüber empfindet ihr Freude, und wo möchtet ihr etwas ändern oder verbessern?
Christine Baumann: Ich meine, dass sich das Orchester gut entwickelt, weil wir beide am selben Strick ziehen und konstant an unserem Ziel arbeiten. Ich finde, die Art zu hören und zu spielen hat sich sehr verändert über die Jahre.
Jürg Surber: Dass die Zusammenarbeit mit Christine so gut ist, ist die Grundvoraussetzung für Weiterentwicklung und Gelingen.
Christine Baumann: Das sehe ich umgekehrt genauso. Manchmal kommt es mir vor, als seien wir ein Team, das sich versteht ohne Worte und gegenseitig blind vertraut.
Jürg Surber: Natürlich sind wir unterwegs auf einem längeren Weg, und manches kann noch wachsen. Und natürlich gibt es auch Grenzen technischer oder musikalischer Art oder in Bezug auf das mögliche Engagement einzelner. Andere wiederum gibt es, die könnten und möchten noch mehr… Wesentlich ist mir die Erfahrung als Gemeinschaft, und darum möchte ich auch niemanden ausschliessen. Dass immer auch wieder einmal junge MitspielerInnen zu uns stossen, ist zusätzlich wichtig. Meine Hoffnung und Befriedigung läge darin, dass man die Zusammenarbeit zwischen uns beiden, aber auch den guten Zusammenhalt innerhalb des Orchesters entsprechend am Klang hören und an der Ausstrahlung spüren kann.
Christine Baumann und Jürg Surber, ich danke euch sehr herzlich für das Gespräch.
10. August 2016
Moderation, Fotos und Gesprächsaufzeichnung: Regula Menges-Bachmann